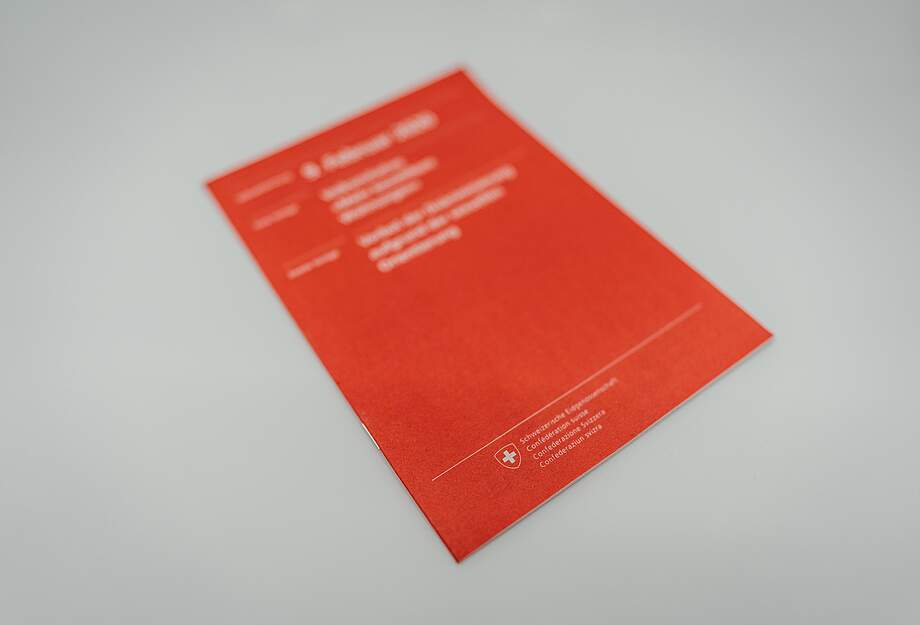Die Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) lehnt eine neue allgemeine Dienstpflicht kategorisch ab. Die Service-Citoyen-Initiative trifft vor allem Frauen, welche bereits heute den Grossteil der unbezahlten Arbeit leisten und mit niedrigeren Löhnen auskommen müssen. Eine allgemeine Dienstpflicht würde diese Ungleichheiten weiter verschärfen – zum Nachteil der Frauen.
Darüber hinaus würden die Bestimmungen zur Dienstpflicht ausgeweitet: In Zukunft sollen neben Armee, Zivildienst und Zivilschutz auch andere Formen des Engagements anerkannt werden. Der Initiativtext bleibt in dieser Hinsicht jedoch sehr vage. Der Bundesrat geht davon aus, dass politische Funktionen, der Einsatz in freiwilligen Feuerwehren oder die bisherigen Tätigkeiten des Zivildienstes (Pflege, Kinderbetreuung, Schule, Naturschutz) ebenfalls als Service citoyen anerkannt werden könnten.
Die Zahl der Personen, die zur Dienstpflicht herangezogen würden, könnte von 35.000 auf etwa 70.000 steigen. Ein grosser Teil würde in Bereichen eingesetzt, in denen heute überwiegend Frauen qualifizierte und bezahlte Arbeit leisten – insbesondere in Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen. Wenn in diesen Sektoren plötzlich Zehntausende ihren Service citoyen ableisteten, würde die Qualität der Leistungen sinken, da diese weniger professionell erbracht würden. Gleichzeitig würde der Druck auf Löhne und Arbeitsplätze steigen, zum Beispiel in medizinisch-sozialen Einrichtungen.
Der Gesundheits- und Sozialbereich ist heute mit einem Mangel an qualifiziertem Personal konfrontiert. Ohne Frauen würde dort nichts funktionieren. Die niedrigen Löhne und die hohe Arbeitsbelastung führen zu einer hohen Fluktuation des Personals. Diese Fluktuation würde sich noch verschärfen, wenn eine grosse Zahl unqualifizierter Personen zum Service citoyen eingesetzt würde. Es ist zu befürchten, dass ein Teil des regulären qualifizierten Personals am Ende durch unqualifizierte, ständig wechselnde und billige Arbeitskräfte ersetzt wird.
Anstatt in diese Sektoren zu investieren, mehr Fachkräfte auszubilden und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit überhaupt genügend qualifiziertes Personal gewonnen werden kann, hätte die Initiative also zur Folge, dass qualifizierte und erfahrene Frauen aus Schlüsselpositionen abgezogen würden, um einen Service citoyen an anderer Stelle zu leisten – noch dazu kaum entschädigt. Der Gipfel wäre, wenn Frauen ihre bezahlte und essenzielle Arbeit in der Pflege oder der Kinderbetreuung unterbrechen müssten, um einen unterbezahlten Service citoyen in denselben Bereichen zu leisten!
Solidarität, Engagement für die Gemeinschaft und ehrenamtliche Arbeit zur Verbesserung der Lebensbedingungen gehören zu den Grundwerten der Gewerkschaftsbewegung. Es ist wichtig, die Rahmenbedingungen für dieses Engagement zu verbessern, doch die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ist nicht der richtige Ansatz. Da Frauen bereits einen deutlich grösseren Anteil der unbezahlten Arbeit für Kindererziehung oder auch die Betreuung kranker Menschen ausserhalb ihrer beruflichen Tätigkeit leisten, erbringen sie bereits täglich einen Service citoyen. Ohne angemessene Entlohnung sollten wir von ihnen kein zusätzliches Engagement für die Gemeinschaft mehr verlangen.
Neben einer Aufwertung der Löhne in Berufen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, wäre es wesentlich sinnvoller, die Arbeitszeit zu verkürzen, um eine bessere Verteilung der unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen zu ermöglichen und eine bessere Vereinbarkeit mit ehrenamtlichem Engagement zu schaffen. Ebenso sollte der Kündigungsschutz für Personen gestärkt werden, die sich für andere engagieren.
Kurz zusammengefasst: Die Service-Citoyen-Initiative zwingt den Frauen noch mehr unterbezahlte Care-Arbeit auf und sie verschlechtert die Arbeitsbedingungen in sogenannten Frauenberufen. Sie ist das Letzte, was wir brauchen!